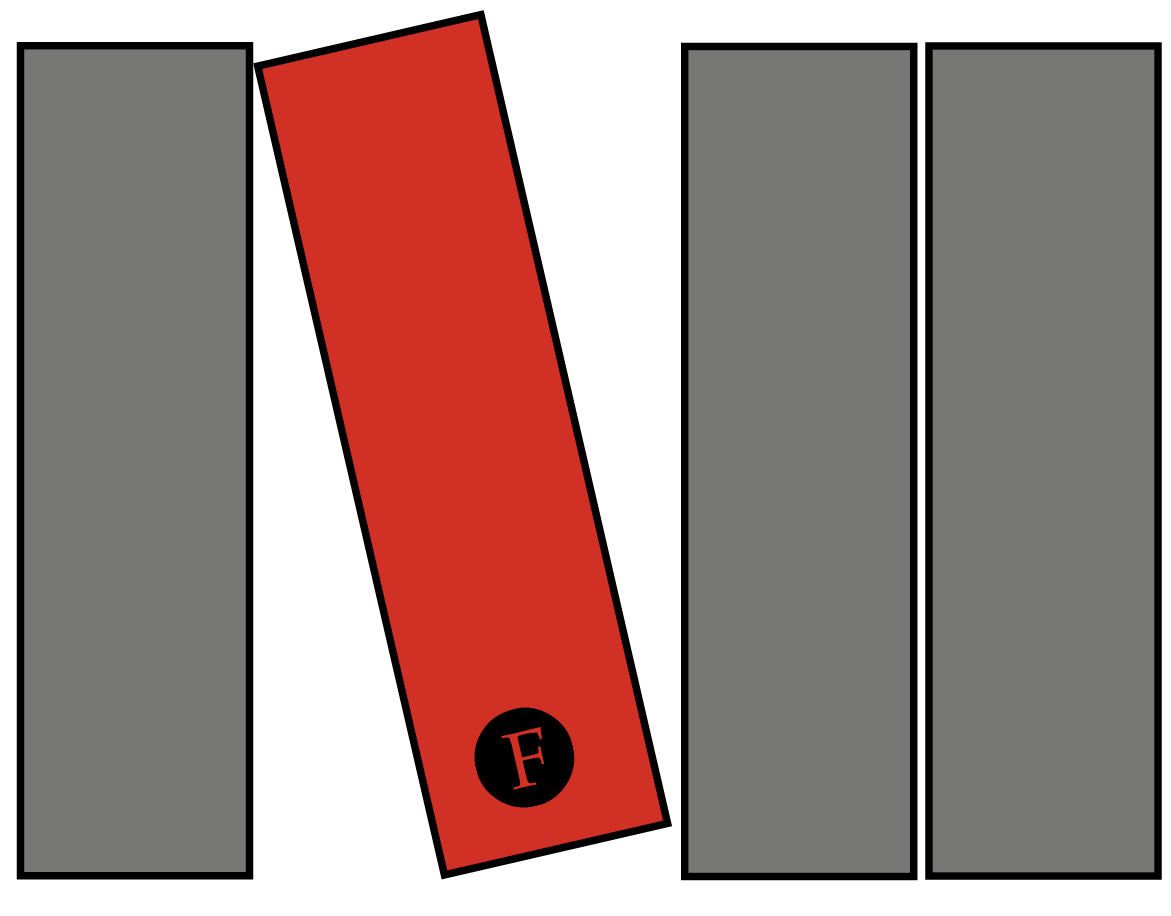Herr Roth & Herr Schwartz und… die dritte Leseprobe
…das Leben
…
»Äh, in welcher Beziehung soll mir denn etwas auffallen?« fragte Herr Schwartz.
»Nun, in Beziehung auf das menschliche Miteinander.«
»Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Oder meinen Sie, daß Sie soeben, ganz gegen Ihre proletarische Gewohnheit, ›Sie‹ zu mir gesagt haben?«
»Genau das meine ich.«
»Was genau meinen Sie?«
»Dieses schwülstige Gelaber und die entsprechende Anrede dazu. Merkst Du nicht, daß Du noch immer ›Sie‹ zu mir sagst, während ich Dich schon ewig duze?«
»Natürlich ist mir das aufgefallen. Da wir indessen keine andere Vereinbarung getroffen haben, halte ich mich an die üblichen gesellschaftlichen Regeln«, bemerkte Herr Schwartz süffisant, ohne jedoch ein gewisses Unbehagen ganz unterdrücken zu können.
»Das klingt zwar steif wie meine Morgenlatte, aber gut, dann treffen wir halt eine solche Vereinbarung, Euer Ehren.«
»In Ordnung«, antwortete Herr Schwartz mit sichtlicher Befriedigung, »wir kennen uns inzwischen schon eine recht lange Zeit, haben uns intensiv ausgetauscht und einige Abenteuer gemeinsam überstanden, um nicht zu sagen, auf wundersame Weise gemeinsam überlebt. So darf ich wohl, als der Ältere von uns beiden, Ihnen das Du anbieten. Ich bin Herr Schwartz«, sagte ebendieser nicht ohne Pathos und erhob dabei sein Glas in Richtung von Herrn Roth, der sofort fröhlich einstimmte: »Na endlich, ich duze Dich zwar seit Anbeginn der Reden, aber dennoch: Du Schwartz, Ich Roth, Salute!«
»Hätten wir das also geklärt, Dann auf Dich, DU rothe Socke!«
»Wurde ja auch Zeit, sonst hätten wir es ja bis zum Ende des Buches gar nicht mehr geschafft. Auf Dich, DU schwartze Seele!«
»Prosit, DU rother Bruder!«
»Prost, DU schwartzer Geselle! Das war ja echt eine schwere Geburt, mein Lieber. Da ist es in unseren linken Kreisen doch wesentlich einfacher, wir duzen uns immer untereinander, so unbeschwert wie in der Jugend bis zur Studentenzeit. Danach fängt der sogenannte Ernst des Lebens an. Plötzlich gelten gesellschaftliche Normen und alles wird schwierig. Bei den Engländern ist das viel einfacher, die sagen kurz und schmerzlos: ›You can say you to me!‹«, gab Herr Roth an dieser Stelle seiner Erleichterung Ausdruck.
»Damit verliert man jedoch auch die Möglichkeit der Differenzierung, die die deutsche Sprache so reichhaltig bietet. Ich möchte diese feinen Nuancen des menschlichen Miteinanders nicht missen, vom kumpelhaften Du, über das intime Du, das gleichberechtigte Sie bis hin zum respektvollen oder gar hochachtenden Sie. Gerade in hierarchischen Verhältnissen sind solche Möglichkeiten Gold wert.«
»Ja, ja, Abstand, Distanz, Regeln wie auf dem diplomatischen Parkett. Was soll das alles? Wir sind doch alle gleich, sind doch alle Menschen, wie Du und ich.
»Ja, nur manche sind gleicher, das kennen wir schon…«
»Lassen wir das und freuen uns an der neuen Nähe. Da will ich Dir gleich mal eine ganz persönliche Frage stellen: Wie siehst Du mich eigentlich?«, fragte Herr Roth.
»Da will ich Dir ganz persönlich antworten«, kam es von Herr Schwartz zurück. Er blickte sich verschwörerisch um, dachte kurz nach, seufzte, um sodann leise schmunzelnd vorsichtig in den Raum zu stellen: »Wenn ich ehrlich bin…«
»Ich bitte darum!«
»Wenn ich also ehrlich bin, dann sehe ich vor meinem geistigen Auge einen gigantischen Abraumbagger von der Größe einer mittleren Kleinstadt aufragen, und ganz unten am Fuße steht ein winziges Männlein davor und pinkelt aufgeregt an die deutlich übermannshohe Kette. Das Männlein hüpft auf und nieder und schreit dabei aus voller Kehle: ›Verrosten soll er, der Kapitalismus!‹ Dieses Männlein hat eine große Ähnlichkeit mit Dir, lieber Roth, und abends, im stillen Kämmerlein, da sitzt es am Schreibtisch beim Biere und spitzt seine Sätze zu vermeintlich gefährlichen Waffen, die es dann unheilvoll drohend auf den Panzer des Establishments richtet und sich wundert, daß es keinerlei Wirkung erzielt. Trotzdem liebt es sein Tun, beruhigt es doch sein Gewissen und verschafft ihm die wunderbare Ausrede: ›Ich habe es Euch doch gesagt.‹«
»Hm, und was machst Du?«, kommt es betreten aus der Ecke von Herrn Roth.
»Warten auf Godot«, kommt die dumpfe Antwort aus der anderen Ecke.
»Da sitzen wir nun, zwei alte Säcke, voller Melancholie weinen wir uns gegenseitig aus und hauen uns unsere Lieschen-Müller-Theorien an die grauen Köpfe. Wie am Stammtisch der Geschichte sitzen wir, ohne zu verstehen kommentieren wir das Sein mit unseren Biertischparolen, etwa wie ein Jäger auf dem Hochsitz, der die Tiere zu seinem Vergnügen jagt, ohne zu verstehen, was er da tut. Dabei sind diese Tiere soviel klüger als wir.«
»Was nützt alles Jammern? Es ist wie es ist. Du polterst und motzt und kotzt dich aus, fluchst auf Gott und die Welt und am Ende sogar auf dich selbst. Wozu? Ich dagegen träume und habe schöne Ideale. Doch die Menschen sind wie sie sind und die meisten wollen gar nichts anderes sein. Wir ändern nichts mit alldem Geschwätz, beruhigen nur unser Gewissen, um uns nicht vor uns selbst zu schämen, suchen wir die Schuld bei anderen. Sind wir nicht beide wie Don Quichote, kämpfen gegen die Windmühlenflügel des menschlichen Unverstandes? Du mit Panzern und Kanonen, ich mit Degen und Florett. Hoch von unserer klapprigen Rosinante der Überheblichkeit sehen wir hinab auf ein Ritterheer von Feinden, auf eine Welt der Gegensätze. Doch diese vermeintlichen Feinde bekämpfen sich gegenseitig und sehen uns als lächerliche Komparsen, als Randfiguren der Geschichte.«
»Quo vadis?, armer Mensch, möchte man fragen. Die Menschen waren wohl selten soweit auf dem Holzweg wie heute. Als ich neulich durch die Natur wanderte, sah ich einen schönen Baum am Boden liegen, gefällt vom Biber, also natürlich gestorben zu einem natürlichen Zweck. Der Baum, der Biber stehen in einem natürlichen Gleichgewicht. Die Natur, deren Urbild uns im wilden Urwald begegnet, so es ihn denn noch gibt, steht im Gegensatz zum gezirkelten Barockgarten, der Perversion der Natur durch den Menschen. Wir leben nicht mit, sondern gegen die Natur. Die Menschen waren noch nie so weit von sich selbst entfernt wie heute, sie spüren nichts, fühlen nicht mehr die feinen Schwingungen des großen ›All-Eins‹. Die Zeit rast, die Entwicklung überschlägt sich, der Mensch vermag nicht mehr zu folgen, bleibt verzweifelt, erschöpft, depressiv, allein zurück.«
»Es ist nicht die Zeit, die rast, wir rasen hochkonzentriert am Leben vorbei. Noch bevor es dem Menschen gelingt, das Grab seiner Zeit mit Leben zu bedecken, ist es schon vorüber und die Blumen des Vergessens bewuchern seine Begräbnisstätte.«
»Ich wünschte, es gäbe einen Gott.«
»Wenn es ihn gäbe, dann wäre er auch in uns, wäre überall.«
»Auch in dieser Fliege?«
»Natürlich, das hätte zudem den Vorteil, daß es sehr viel Gott gäbe. Denn da es sehr viele Menschen gibt, die sehr viel Scheiße machen, gibt es auch sehr viele Fliegen, die sich darum sammeln.«
»Dann wäre Gott tatsächlich allgegenwärtig, wäre auch in dieser Fliege.«
»Ja, wahrscheinlich mehr als in uns…«
»Dann ist das also Gott?«
»Ich fürchte ja.«
»Dann habe ich neulich Gott erschlagen!«
»Gott ist unsterblich.«…